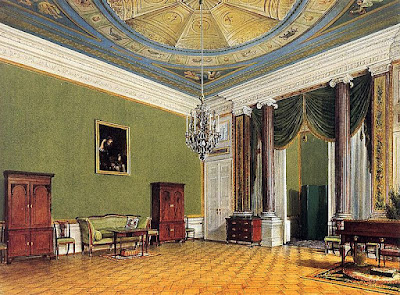Der Preußenkönig Friedrich II oder Friedrich der Große (geb.1712, gest.1786), volkstümlich der „Alte Fritz“ genannt ging gerne unerkannt in Gasthäuser um seinen Untertanen aufs „Maul“ zu schauen. Darüber berichtet in einer heiteren Anekdote im Wiener Tagblatt am 22. August 1936 Otto Andrien. Der Artikel wurde etwas gekürzt und unserer Zeit angepasst.
Eines Tages trat er außerhalb Potsdams in ein Wirtshaus ein und traf dort einen Grenadier (Soldat), der unaufhörlich trank. Den Kerl wollte er sich näher ansehen und deshalb setzte er sich an dessen Tisch und hatte sich bald mit ihm angefreundet. Der Grenadier ließ einen neuen Humpen bringen und wollte mit seinem neuen Freund um die Wette trinken. In solchen Dingen war der alte Fritz kein Spaßverderber, nur wollte er auch wissen, wer die Zeche begleichen werde. Das lasse nur meine Sorge sein, sagte der Grenadier und nötigte den König zur Bruderschaft. Als sie eine Weile getrunken hatten, fragte der alte Fritz noch einmal: „Woher hast du das Geld? Der preußische König zahlt doch wenig Sold.“ „Ei freilich,“ lächelte der Soldat, „wenn man auf des Königs Sold angewiesen wäre, könnte man sich nur selten einen guten Schluck vergönnen. Wir Soldaten wissen aber auch anderswo Geld zu kriegen.
Hast du schon einmal vom preußischen Kniff gehört ?“ „Vom preußischen Kniff... ?“ Der König horchte verwundert auf. Er hatte noch nie davon reden gehört. Der Grenadier war darüber belustigt. „Du weißt nicht, was der preußische Kniff ist? Ja was bist du für ein Soldat? Ich will dir die Sache gleich erklären: Der preußische Kniff besteht darin, dass man alles versetzt, was vom preußischen König ist. Beispielsweise: „Wozu brauchen wir Soldaten jetzt mitten im Frieden eine geschliffene Säbelklinge? Ich habe die meine versetzt und mir dafür eine solche aus Holz geschnitzt.“ Dabei zog er den Säbel und hielt dem verdutzten König tatsächlich eine hölzerne Säbelklinge unter die Nase. Der König schaute eine Weile, dann verabschiedete er sich. Dieser preußische Kniff hatte ihn ein wenig hergenommen.
Einige Tage später musste das Regiment, dem der trinkfeste Grenadier angehört hatte, zur Inspektion aufs Truppenfeld. Der alte Fritz tritt mit finsterer Miene die Front ab und hatte bald den Zecher mit der hölzernen Klinge entdeckt. Er ließ nun ihn und seinen Nebenmann vortreten und befahl mit drohender Stimme dem ersteren: „Zieh’ deinen Säbel und schlage deinem Nebenmann den Kopf ab“. Der Grenadier, der nun in seinem König seinen Zechkumpan erkannte, wurde kreidebleich, fasste sich aber dennoch und bat: „Majestät, mein Nebenmann hat mir ja nichts zuleid’ getan, er ist mein bester Freund... .“ Der König wollte aber eine Lehre geben. Er gab deshalb nicht nach und schrie: „Zieh’ den Säbel, sonst befehle ich deinem Nebenmann, dass er dir den Kopf abschlägt“. Da blieb dem Grenadier nichts andres übrig, als zu tun, wie es der König befohlen hatte, er legte seine Hand auf den Griff, schöpfte tief Atem und rief: „Wenn mir der König so etwas befiehlt dann möge Gott meiner Seele gnädig sein und meine Säbelklinge zu Holz werden lassen!“ Damit zog er sein Holzschwert und schlug seinem Kameraden auf die Schulter, dass es in Stücke brach. Die andern Soldaten glaubten, es sei ein Wunder geschehen.
Nur der König wusste, was sich wirklich zugetragen hatte, lächelte und sagte: „Er versteht seinen preußischen Kniff wirklich gut. Da er aber mit seinem Mund nicht minder schlagfertig als mit seiner Faust ist, so sei ihm dieser preußische Kniff verziehen.“
Dann wendete er sein Pferd und befahl, dass man dem Grenadier aus den Heeresbeständen einen neuen Säbel geben möge. Der preußische Kniff wurde fortan aber in der Armee des alten Fritz nie mehr angewandt.
Dann wendete er sein Pferd und befahl, dass man dem Grenadier aus den Heeresbeständen einen neuen Säbel geben möge. Der preußische Kniff wurde fortan aber in der Armee des alten Fritz nie mehr angewandt.